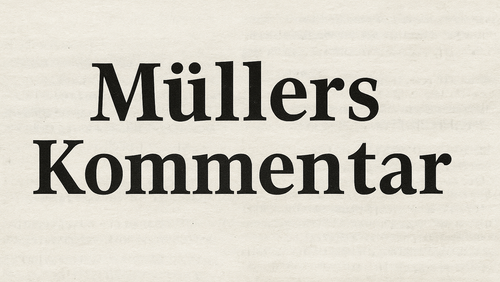
08/11/2025 0 Kommentare
»What the EXNOVATION?«
»What the EXNOVATION?«
# Kommentar
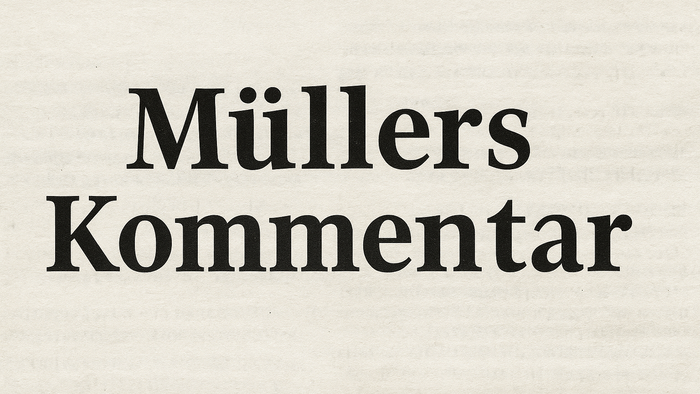
»What the EXNOVATION?«
Kürzlich sagte mir eine Kollegin, mit jener entspannten Zuversicht, die sonst nach erfolgreichen Achtsamkeitsseminaren auftritt: »Wir haben den Gesprächskreis jetzt exnoviert.« Ich hörte heraus: Weniger Termine, weniger Verantwortung, weniger Druck. Ein bisschen Exnovation für die persönliche Work-Life-Balance. Die moderne, spirituell legitimierte Form von: »Irgendwann ist auch einmal gut.«
Dabei hat der Begriff ursprünglich überhaupt nichts mit Entlastung zu tun. Exnovation kommt aus der Organisationsforschung und bezeichnet das bewusste Beenden von Routinen, Programmen und Strukturen, die ihren Zweck verloren haben. Es ist keine Arbeitszeiterleichterung, sondern ein strategischer Eingriff. Gemeinden müssen Gewohnheiten ändern, nicht mehr alles bedienen wollen, sondern sich fokussieren. Das klingt nüchtern und richtig.
Pastoraltherapeutische Vermischung
Doch im kirchlichen Gebrauch verschiebt sich die Bedeutung auffällig schnell. Aus strategischer Exnovation wird pastoraltherapeutische Selbstfürsorge. Das Ende einer Gruppe bedeutet plötzlich nicht: Wir räumen auf, um Neues zu ermöglichen. Sondern: Wir müssen auf uns achten. Wir können auch einmal Nein sagen. Wir müssen nicht immer leisten.
Das Problem liegt nicht in der Ermutigung zur Selbstsorge. Die ist sinnvoll. Das Problem liegt in der Verwechslung. Wer Exnovation nach innen richtet – auf die eigene Erschöpfung, nicht auf die Struktur – erzeugt Entlastung ohne Transformation. Das fühlt sich freundlich an, aber es verändert nichts. Es ist die kirchliche Version eines Kaminfeuerscreens: atmosphärisch warm, organisatorisch folgenlos.
Exnovation braucht ein Ziel
Dabei betont die einschlägige Transformationsforschung sehr deutlich, dass Exnovation lediglich der erste Schritt eines zweistufigen Prozesses ist. Der zweite ist die Innovation: die Entwicklung neuer Formen von Gemeinschaft, neuer Bildungsräume, neuer seelsorglicher Präsenz. Exnovation schafft die Kapazität; Innovation nutzt sie. Dieser Zusammenhang ist in der Theorie eindeutig. In der Praxis kirchlicher Diskussionen jedoch bleibt häufig nur der entlastende Teil hängen: das Weniger. Der aufbauende Teil – der, der Arbeit bedeutet – wird gerne überhört.
Und genau hier liegt das Problem. Exnovation ist keine Einladung zum Rückzug und kein schonend verpacktes »Wir reduzieren jetzt die Stunden«. Exnovation verlangt Umbau. Sie verlangt Entscheidungen darüber, was künftig Priorität hat und was nicht. Sie verlangt das Überprüfen von Traditionen, das Neuordnen von Zuständigkeiten, das Aushalten von Konflikten. Kurz: Sie verlangt Führung. Und sie verlangt den Willen zur Gestaltungsarbeit.
Exnovation versus Work-Life-Balance
Dass dabei Kraft, Zeit und finanzielle Mittel benötigt werden, ist kein Nebenbefund, sondern das Wesensmerkmal der Sache. Eine Gemeinde, die etwas bewusst beendet, muss ebenso bewusst etwas beginnen. Wird Exnovation hingegen lediglich als elegant formulierte Arbeitsreduktion verstanden, führt sie nicht zur Erneuerung, sondern zu einer langsameren, höflicheren Form des Rückzugs. Die Institution wirkt dann zwar erleichtert, aber nicht richtungsstärker.
Wer also von »Exnovation« spricht, muss im selben Atemzug auch über »Innovation« sprechen. Wer über Arbeitsentlastung reden möchte, soll das tun, aber dann bitte ohne Exnovation als bequeme Legitimationsformel vorzuschieben. Exnovation meint – in ihrer eigentlichen Bedeutung – eine Phase des Umbaus, in der die Arbeit nicht weniger, sondern zunächst mehr wird: Entscheiden, Beenden, Neuordnen, Neuanfangen. Sie ist darum nicht mit der gegenwärtigen Work-Life-Balance-Rhetorik zu verwechseln, die gerne das Weniger feiert, aber selten das Wohin benennt. Das Ende von Gewohntem gewinnt nur dann Sinn, wenn ebenso klar ist, was an seine Stelle treten soll. Die Zukunft der Kirche entscheidet sich nicht daran, was wir lassen, sondern daran, was wir zu tun bereit sind.
PS: Ich habe einmal einen Achtsamkeitskurs besucht, falls Sie fragen.


Kommentare